Sándor Veress (1907–1992)
Tradition und Gegenwart
Ein Portrait des Komponisten, Pädagogen und Musikethnologen
 Als Sándor Veress 1960 an seinem Konzert für Streichquartett arbeitete, äusserte er über sein Komponieren, dass er «die Zusammenfassung von Tradition und Gegenwart zu einer grossen Synthese ... für die einzige mögliche Lösung im Schadenzeitalter des intellektuellen und antiintellektuellen Barbarismus» halte. Diese Einschätzung kennzeichnet das künstlerische Verständnis von Veress treffend. Fest verwurzelt in die europäischen humanistischen Traditionen, die er für eine unabdingbare Basis jeglicher geistiger Tätigkeit und Entwicklung hielt, und gleichzeitig allem ungestümen Fortschritt misstrauend, liess er sich nie in irgend eine epigonale Ecke oder Methode drängen. Der Komponist Veress suchte, geprägt durch ein von Faschismus und Stalinismus, von Exil und Heimatsuche überschattetes Leben, immer wieder neue kompositorische Lösungen von grosser persönlicher Eigenart. Im Konzert für Streichquartett, aber nicht nur in ihm, sondern in fast allen seinen Werken lässt sich der Versuch einer Synthese von historisch gewachsenen Traditionen und einer zeitgemässen Sprache beobachten.
Als Sándor Veress 1960 an seinem Konzert für Streichquartett arbeitete, äusserte er über sein Komponieren, dass er «die Zusammenfassung von Tradition und Gegenwart zu einer grossen Synthese ... für die einzige mögliche Lösung im Schadenzeitalter des intellektuellen und antiintellektuellen Barbarismus» halte. Diese Einschätzung kennzeichnet das künstlerische Verständnis von Veress treffend. Fest verwurzelt in die europäischen humanistischen Traditionen, die er für eine unabdingbare Basis jeglicher geistiger Tätigkeit und Entwicklung hielt, und gleichzeitig allem ungestümen Fortschritt misstrauend, liess er sich nie in irgend eine epigonale Ecke oder Methode drängen. Der Komponist Veress suchte, geprägt durch ein von Faschismus und Stalinismus, von Exil und Heimatsuche überschattetes Leben, immer wieder neue kompositorische Lösungen von grosser persönlicher Eigenart. Im Konzert für Streichquartett, aber nicht nur in ihm, sondern in fast allen seinen Werken lässt sich der Versuch einer Synthese von historisch gewachsenen Traditionen und einer zeitgemässen Sprache beobachten.
Sándor Veress wurde am 1. Februar 1907 in Kolozsvár (Klausenburg, heute Cluj-Napoca im siebenbürgischen Rumänien) geboren.
«Keine schlechte Geburtsstadt, wenn man bedenkt, dass auch der grosse Renaissancekönig Matthias Corvinus dort geboren wurde».
1916 übersiedelte die Familie nach Budapest, wo Veress 1925 in der Musikakademie bei Zoltán Kodály Komposition und bei Béla Bartók Klavier studierte. In seinem letzten Studienjahr begann er seine Tätigkeit als Volonteur an der Volksmusikabteilung des ethnographischen Museums unter der Leitung von László Lajtha. Seine erste bedeutende ethnologische Expedition führte ihn zu den Csángó-Magyaren in die Moldau. Bartóks Programm einer neuen ungarischen Musik, die sowohl auf der Höhe ihrer Zeit steht und zugleich in dem musikalischen Reichtum der neuentdeckten Volksmusik wurzelt, entsprach Veress’ eigenem Weg. Vor dem Hintergrund dieser vielgestaltigen Ausbildung reifte Veress zum Pianisten, Pädagogen, Komponisten und Musikethnologen.
«Anfangs bin ich natürlich Kodály und Bartók in der kompositorischen Behandlung des volksmusikalischen Materials gefolgt, aber schon ziemlich früh und nicht zuletzt durch die fruchtbaren Anregungen von Lajtha habe ich angefangen, mit der volksmusikalischen Materie zu experimentieren, indem ich versuchte, die Motivik eines Liedes strukturell auszuwerten, also nicht irgend ein Lied mit irgendeiner Begleitung zu versehen, sondern ein ganzes Stück aus dem motivischen Material zu komponieren.»
Mit Studienfreunden, Komponisten und Interpreten gründete er eine kleine Gesellschaft, die MoMaMu (Modern Magyar Muzsikusok, Moderne Ungarische Musiker), die im Kleinen Saal der Akademie Konzerte veranstaltete. Ausserdem traf sich die junge Budapester Musikergeneration am Samstag im Café Edison, wo über Musik, Literatur und Politik diskutiert wurde.
«Wenn einer eine neue Komposition fertig hatte, so haben wir das Stück gemeinsam begutachtet».
1933 gab Veress mit dem 1. Streichquartett und der Sonatine für Klavier in Budapest sein Debut als Komponist.
«Von den Modernen haben mich neben Kodály, Bartók und auch Lajtha vor allem Hindemith und Strawinsky beschäftigt.»
In seiner sogenannten «Sonatinenzeit» der Dreissiger Jahre hat Veress diese neoklassizistischen Impulse von Hindemith, zugleich aber auch Bachs Linearität, Beethovens Dynamik und Debussys Sensibilität für den Klang verarbeitet. Mit dem 2. Streichquartett und dem Ballett «Die Wunderschalmei» (1936/37) fand Veress seine persönliche Ausdrucksweise. Das 1. Streichquartett erklang 1935 im Rahmen des Festes der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik (IGNM) in Prag, das 2. Streichquartett 1937 beim IGNM-Fest in Paris: Veress fand als Komponist erstmals europäische Anerkennung.
In den frühen dreissiger Jahren begann Veress auch seine Tätigkeit als Instrumentalpädagoge. Er gründete in Budapest das Musikpädagogische Seminar und studierte auf Reisen nach Berlin (1933) und London (1938/39) die dortigen Formen der Musikerziehung. Es war Veress, der in den Jahren 1939–47 den Weg zur Erneuerung der ungarischen Instrumentalpädagogik vorzeichnete.
1939 spitze sich angesichts der politischen Entwicklung und des Kriegsausbruchs immer mehr die Frage zu: bleiben oder Ungarn verlassen? In London, wohin seine künftige Frau Enid zurückgekehrt war, prüfte er die Möglichkeiten, eine Existenz aufzubauen. Der renommierte Verlag Boosey & Hawkes bot Veress, gleichzeitig mit Bartók, einen Generalvertrag an. Die Überzeugung, dass «eine organische Weiterentwicklung» seines Komponierens nicht möglich gewesen wäre, und die Gefahr einer totalen Isolation in England bekräftigten ihn im Entscheid, trotz zahlreicher Warnungen nach Ungarn zurückzukehren.
«Es wäre noch zu früh gewesen, Ungarn zu verlassen, und so wären einige vielleicht wichtige Werke wie zum Beispiel der St. Augustinus-Psalm nicht entstanden».
Während eines Romaufenthalts 1942/43 erlebte Veress die Aufführung von Alban Bergs Oper «Wozzeck», ein entscheidendes Kunsterlebnis, wie er immer wieder bestätigt hat: «Ich habe 1942 alle Proben und die sieben Aufführungen mit Tullio Serafin erlebt.»
1943 wurde Veress Nachfolger von Kodály als Professor für Komposition an der Budapester Musikhochschule. Aber das Ende des Weltkriegs veränderte seine Heimat grundlegend. Nach der Invasion der Nationalsozialisten folgte 1944 jene der Roten Armee und, in ihrem Gefolge, die schleichende Machtübernahme der stalinistisch linientreuen KP unter Mátyás Rákosi. Das politische Klima verschlechterte sich 1948 drastisch. Sämtliche Erwartungen an den kulturellen Wiederaufbau eines nun demokratischen Ungarn, die auch Veress vorerst noch gehegt hatte, zerschlugen sich sehr schnell.
«Leider dauerte die Euphorie des Friedens und der hoffnungsvollen Konsolidierung der politischen Verhältnisse nicht lange.»
Erneut sondierte Veress Emigrationsmöglichkeiten, wobei nebst Australien und Neuseeland insbesondere die USA als Möglichkeit für einen Neuanfang ins Auge gefasst wurde. Im September 1948 besuchte Veress als offizieller Delegierter den Kongress des International Folk Music Council in Basel, wo er Kontakte zu Paul Sacher knüpfte, der 1950 in Zürich erstmals die «Transsylvanischen Tänze» dirigierte. Sacher brachte später auch das Klavierkonzert und das eingangs genannte Konzert für Streichquartett und Orchester zur Uraufführung. Aufgrund einer Einladung zur Uraufführung seines Balletts «Térszili Katicza» reiste Veress 1949 gemeinsam mit dem Choreographen Aurél M. Milloss zuerst nach Stockholm und anschliessend nach Rom. In Italien schloss Veress einen Generalvertrag mit dem Verlag Suvini Zerboni in Mailand ab.
Der Entschluss zur Emigration war bereits vor dieser Reise gefallen.
«Meine Frau konnte mir nach etwa sechs Wochen folgen, und nun sassen wir in der heiligen Stadt und warteten auf das grosse Wunder, was mit uns geschehen sollte.»
Der Budapester Schauprozess und das Todesurteil gegen den mit Veress befreundeten ehemaligen Aussenminister Rajk hatten eine allzu deutliche Sprache gesprochen:
«In Rom verfolgte ich diese Schandtat im Radio, die mir klar gemacht hat, wie tief mein Land heruntergekommen ist und ich entschloss mich endgültig, den Weg der Emigration anzutreten ... Nach neun Monaten geschah das Wunder in der Form der Einladung zu einer Gastprofessur in Bern. Was mir in Ungarn unmöglich gewesen wäre, die menschenwürdige persönliche Freiheit und die Möglichkeiten zur Entfaltung meiner Kunst, hat mir der helvetische Boden geschenkt.»
Den Weg nach Bern hatte der Musikwissenschaftler Ottó Gombosi, ein Freund aus Budapester Studienjahren, vermittelt. Er schlug Veress am Berner musikwissenschaftlichen Seminar als Vertretung für das Wintersemester 1949/50 vor; seit dem Tod von Ernst Kurth 1946 war der dortige Lehrstuhl für Musikwissenschaft verwaist. 1950 wurde Veress von Alphonse Brun als Lehrer für Harmonielehre, Kontrapunkt und Komposition an das Konservatorium der Stadt Bern berufen. Zugleich übernahm er den Unterricht in Allgemeiner Musikpädagogik, mit der er ein neues ständiges Lehrfach und zugleich eine vergleichende Kulturgeschichte anbot.
Eine enge künstlerische Beziehung entstand ausserdem zu Hermann Müller. Ihm und dem Berner Kammerorchester ist die «Hommage à Paul Klee» für zwei Klaviere und Streichorchester gewidmet, in der sich ein für Veress sehr bedeutendes Kunsterlebnis niederschlägt, seine Begegnung mit den Bildern von Paul Klee 1951 im Haus der Familie Müller-Widmann. In diesem Haus auf dem Bruderholz in Basel fand Veress 1951-53 jeweils im Sommer eine Zuflucht, gewissermassen «eine Erbschaft von Bartók».
1968 erhielt Veress einen Lehrstuhl für Musikethnologie und Musik des 20. Jahrhunderts an der Universität Bern. Dazu gesellten sich Gastdozenturen, 1965/66 und 1966/67 in Baltimore, 1965 in Adelaide und 1972 an der University of Portland, Oregon. Bern aber blieb das Zentrum von Veress’ Lebensweg. 1975 erhielt er den Kantonalen Musikpreis und 1986 den Komponistenpreis des Schweizerischen Tonkünstlervereins.
Für Veress wurde die Schweiz, wurde Bern zu einer neuen Heimat. Ein Schweizer Komponist ist er aber nie geworden. Von der ungarischen Heimat geographisch getrennt zu sein hiess für Veress vorerst, von der ursprünglichen musikalischen Quelle, der gehörten, gesammelten, transkribierten und analysierten Volksmusik abgeschnitten zu sein. Veress öffnete sich in der Schweiz vermehrt der abendländischen Moderne, der Zwölftontechnik Weberns und Bergs. Aber der Einbezug neuer Techniken brachten nicht neue Methoden, sondern eine Revision der materiellen Basis seines Komponierens mit sich. Veress hatte sowohl als Komponist wie auch als Pädagoge seit jeher «den Typus des automatisierten Individuums, das allmählich seine Fähigkeit zu freiem Handeln verliert» als die grösste Gefahr seines Zeitalters betrachtet.
Freundschaften und künstlerische Kontakte wie jene zu Hermann Müller, dem Leiter des Berner Kammerorchesters, zu Paul Sacher oder zur Camerata Bern, insbesondere aber zu seinen Schülern am Konservatorium und an der Universität führten in den fünfziger und sechziger Jahren zu mehreren Kompositionsaufträgen. Der letzten Schaffensperiode, die mit dem «Glasklängespiel» um 1977 beginnt, ging eine zehnjährige Pause im Komponieren voraus. Dieser Rückzug als Komponist ist auf ein ganzes Geflecht von äusseren und inneren Gründen zurückzuführen. Dazu gehört insbesondere die dauernd isolierte Situation im Schweizer Exil, als das Veress sein Leben in Bern verstand und das ihm auch mangels Auseinandersetzung mit Kollegen wenig äussere Anregung gab. Dazu gehört aber mindestens ebenso sehr die zunehmende Divergenz zwischen seinen ästhetischen Positionen, seinen durch die europäische Kulturgeschichte geprägten Kunstbegriff, und den tonangebenden Strömungen der Neuen Musik. Aufschlussreich ist ein Brief aus jener Zeit an den befreundeten Freiburger Musikpädagogen und –historiker Erich Doflein:
«So versuche ich hier etwas zu komponieren, wenn es noch geht. Es wird immer schwieriger, wenn man nicht die Lust hat, mit den Wölfen zu heulen. Leider, ob man will oder nicht, die Frage stellt sich immer zwingender nach dem Sinn des Komponierens, und in meiner völligen Isoliertheit werden solche Gedanken noch mehr verschärft.»
Sándor Veress ist am 4. März 1992 in Bern im Alter von 85 Jahren gestorben. Eine dauernde Rückkehr nach Ungarn war aufgrund seiner schweren Krankheit nicht mehr möglich gewesen.
Veress’ nicht kleines aber überschaubares Œuvre von nicht ganz siebzig Werken , die Jugendkompositionen nicht mitgezählt, ist gekennzeichnet durch eine sehr persönliche und überaus vielfältige Sprache. Seine Musik sucht nicht den vordergründigen oder lauten Effekt. Bei allem Humor, der in manchen Werken durchscheint, äussert sich in seiner Musik ein hohes Verantwortungsbewusstsein, ein tiefer Ernst gegenüber den Traditionen, gegenüber den Kulturen, gegenüber seinem «Tonmaterial».
«Ein Ton – das klingt ja ganz schön; aber dann der zweite ...!»
Diese musikalische Ethik weiterzugeben verstand Veress auch als primäre Aufgabe in seinem Unterricht. Sein Schüler Roland Moser hat dieses Bewusstsein wie folgt formuliert:
«Für Veress ist die Musik eine Einheit, Volksmusik und Kunstmusik aller Zeiten und Länder umfassend. Der Musiker ist dieser Ganzheit gegenüber verantwortlich. Ein ‚Vergehen an der Musik’ muss ihn deshalb persönlich treffen. Das Gefälle zwischen hohem Verantwortungsbewusstsein und geringen Einflussmöglichkeiten ist sein grösstes Problem. Für Veress ist das Unterrichten – und darüber hinaus der pädagogische Auftrag allgemein – deshalb von so zentraler Bedeutung. Die Vorstellung, an einem Ganzen zu arbeiten, von dem immer nur Teile sichtbar und bearbeitbar sind, hat sich mir in den Stunden mit Sándor Veress tief eingeprägt. Diesem Ganzen verpflichtet sein heisst aber nicht, sich mit allem beschäftigen zu müssen. Es zählt die Intensität, die ganze Hingabe, die Ausdauer, den als richtig erkannten Weg so weit wie möglich zu gehen.»
Der bedeutendste Kompositionslehrer der Schweiz der fünfziger, sechziger und siebziger Jahre wurde erst 1974, ein Vierteljahrhundert nach seiner Emigration in die Schweiz, als Mitglied in den Schweizerischen Tonkünstlerverein aufgenommen. Noch 1982, als ihm die «Schweizerische Musikzeitung» zum 75. Geburtstag eine Sondernummer widmete, «husteten einige einflussreiche, gestandene Deutschschweizer Komponisten sehr vernehmlich» (der Redaktor Jürg Stenzl). So fand sich in den letzten Jahren der Name Veress nebst in einigen Berner Statistiken und einzelnen Konzertprogrammen vor allem in den Biographien seiner Schüler, und das sind überaus gewichtige Namen:
An der Budapester Musikhochschule waren György Ligeti und György Kurtág, die beiden bedeutendsten ungarischen Komponisten der Nachkriegszeit, seine Schüler.
In Bern waren eine halbe Generation von Schweizer Musikern und Komponisten seine Schüler: Heinz Holliger, Roland Moser, Heinz Marti, Urs Peter Schneider, Jürg Wyttenbach. Allein angesichts dieser Namensliste wird deutlich, dass Veress einer der wirksamsten Kompositionslehrer des 20. Jahrhunderts ist, der «als Vorbild und überragende Persönlichkeit von hohem geistigem Rang einen bedeutenden Einfluss auf die junge Generation ausgeübt hat» (Paul Sacher).
Veress war, ganz allgemein gesagt, ein reflektierender Künstler, ein poeta doctus, und er hatte, nicht zuletzt am Beispiel seines Vaters, des Historikers Endre Veress, die Breite geschichtlichen Denkens erfahren. Die geschichtliche Perspektive bestimmt denn auch eine ganze Reihe von Kompositionen, was sich rein äusserlich etwa in Werk- und Satztiteln wie Ricercar oder Madrigal, Passacaglia oder Sonata ablesen lässt. Veress selber hat verschiedentlich darauf aufmerksam gemacht, dass er sich oft von alten Techniken und Strukturen anregen liess. In seinen biographischen Erinnerungen brachte er die kompositorischen Prinzipen seiner Studienzeit bei Kodály auf die Formel: «Palestrina, Madrigalkunst war aktuell.» Diese abendländischen Traditionen, die musikalischen und historischen, sind für Veress die künstlerische Heimat geblieben, eine Heimat ohne nationale Grenzen, die er in seinen Kompositionen in eine neue Gegenwart, in seine ganz eigene moderne Sprache hinübergeführt hat.
Hanspeter Renggli
Quellen
Andreas Traub, Sándor Veress. Lebensweg – Schaffensweg;
Jürg Stenzl, Sándor Veress – Auf der Suche nach der verlorenen Heimat; Thomas Gerlich, Zum ‚Corale’-Satz in Sándor Veress’ «Glasklängespiel»
Im Internet
Weitere Informationen zu Sàndor Veress finden Sie unter: www.veress.net








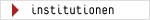






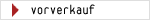


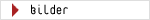
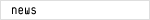
 Als Sándor Veress 1960 an seinem Konzert für Streichquartett arbeitete, äusserte er über sein Komponieren, dass er «die Zusammenfassung von Tradition und Gegenwart zu einer grossen Synthese ... für die einzige mögliche Lösung im Schadenzeitalter des intellektuellen und antiintellektuellen Barbarismus» halte. Diese Einschätzung kennzeichnet das künstlerische Verständnis von Veress treffend. Fest verwurzelt in die europäischen humanistischen Traditionen, die er für eine unabdingbare Basis jeglicher geistiger Tätigkeit und Entwicklung hielt, und gleichzeitig allem ungestümen Fortschritt misstrauend, liess er sich nie in irgend eine epigonale Ecke oder Methode drängen. Der Komponist Veress suchte, geprägt durch ein von Faschismus und Stalinismus, von Exil und Heimatsuche überschattetes Leben, immer wieder neue kompositorische Lösungen von grosser persönlicher Eigenart. Im Konzert für Streichquartett, aber nicht nur in ihm, sondern in fast allen seinen Werken lässt sich der Versuch einer Synthese von historisch gewachsenen Traditionen und einer zeitgemässen Sprache beobachten.
Als Sándor Veress 1960 an seinem Konzert für Streichquartett arbeitete, äusserte er über sein Komponieren, dass er «die Zusammenfassung von Tradition und Gegenwart zu einer grossen Synthese ... für die einzige mögliche Lösung im Schadenzeitalter des intellektuellen und antiintellektuellen Barbarismus» halte. Diese Einschätzung kennzeichnet das künstlerische Verständnis von Veress treffend. Fest verwurzelt in die europäischen humanistischen Traditionen, die er für eine unabdingbare Basis jeglicher geistiger Tätigkeit und Entwicklung hielt, und gleichzeitig allem ungestümen Fortschritt misstrauend, liess er sich nie in irgend eine epigonale Ecke oder Methode drängen. Der Komponist Veress suchte, geprägt durch ein von Faschismus und Stalinismus, von Exil und Heimatsuche überschattetes Leben, immer wieder neue kompositorische Lösungen von grosser persönlicher Eigenart. Im Konzert für Streichquartett, aber nicht nur in ihm, sondern in fast allen seinen Werken lässt sich der Versuch einer Synthese von historisch gewachsenen Traditionen und einer zeitgemässen Sprache beobachten.